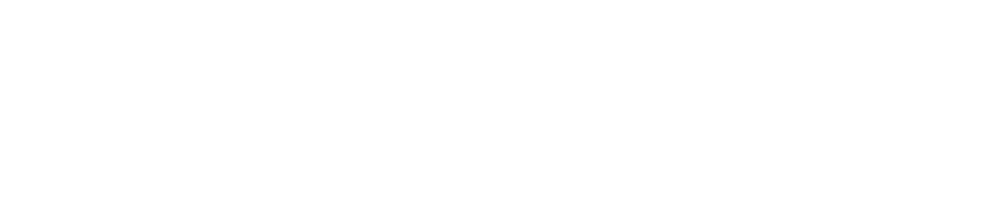Ein bekannter Fotograf hat mich während eines Workshops, den er gab und an dem ich teilgenommen habe, gefragt, was ich denn beruflich so machen würde. Ich antwortete ihm wahrheitsgemäß, dass ich mein Geld in der IT Branche erwirtschafte. Das fand er sehr interessant, denn – so gab er mir als Antwort – die meisten seiner Teilnehmer seien in eben dieser Branche unterwegs, oder sind beruflich zumindest sehr IT affin. Ich habe lange darüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Der erste Reflex wäre, zu behaupten, das liegt an all den technischen Spielereien, die moderne Spiegelreflex-Kameras heute erlauben. Der Reflex könnte falscher nicht sein.
Manchmal wünschte ich, ich könnte einfach nur auf dem Auslöser drücken und es kommt das dabei rum, was ich mir in meinem Kopf so ausgedacht habe. Nicht die technischen Möglichkeiten sind die treibende Kraft, sondern der Gegensatz. Im beruflichen Alltag ist man gerade in der IT-Branche die überwiegende Zeit damit beschäftigt pragmatische Lösungen zu suchen. Für Kreativität bleibt kein Spielraum.
Und genau das ist es, was ich bei der Fotografie finde: die Kreativität und die Muse, etwas entstehen zu lassen, wie man es sich wünscht, oder auch mal etwas entstehen zu lassen, von dem man keine Ahnung hat, wie es am Ende aussehen wird. Das ist meine treibende Kraft. Es ist ein Ausgleich.
Mein Leben mit der Kamera
Meine erste Kamera habe ich bereits mit 10 Jahren in den Hände gehalten. Ich erinnere mich genau an den ersten Film, den ich damals durchgeschossen habe, an all die Fummelei mit Film einlegen und hoffen, dass er mit dem Drehen am Transporträdchen auch wirklich weitertransportiert wird. An das Warten auf die entwickelten Bilder. Es hatte aus heutiger Sicht etwas unglaublich Entschleunigendes an sich. In der Jugend geriet das Interesse an der Fotografie ein wenig in den Hintergrund. Nur um später verstärkt zurück zukommen. Meine erste Spiegelreflexkamera war ein ostdeutsches Produkt: eine Praktica BMS. Diese Kamera begleitete mich lange Zeit und kam gut rum in der Welt: USA, Australien, Thailand. Es war teilweise ein abenteuerliches Unterfangen mit 20 Filmrollen im Gepäck, immer begleitet von der Angst, die Filme können durch die Röntgengeräte am Flughafen, oder durch Hitze oder Feuchtigkeit Schaden nehmen.
In den Nullerjahren dieses Jahrhunderts stieg ich dann auf eine Canon EOS 500 um, begünstigt durch die Tatsache, dass meine Frau im Besitz einer solchen Spiegelreflex-Kamera war (und auch heute noch ist, so wie auch die Praktica noch als Museumsstück hier herumliegt). Mit der Geburt unseres ersten Kindes begann der Einstieg in die digitale Fotowelt. Zuerst mit einer Sony-Kompaktkamera (die hatte für damalige Verhältnisse unglaubliche 3 Megapixel Auflösung, war aber ungeheuer träge beim Fokussieren und Auslösen). Später folgte dann das erste digitale Spiegelreflex-Kit: eine Canon EOS 400D mit einem 55mm f3,5 – 5,6 Kit-Objektiv. War ’ne tolle Zeit.
„Nicht die Kamera ist der limitierende Faktor für ein gutes Foto,
sondern der Fotograf“
Eine analoge Kamera hatte ich zuletzt 2005 im Gepäck (Canon EOS 500). Damals ging es nach Namibia. Mit dabei ein fürchterliches 300mm Tamron-Objektiv, das ich am liebsten im Sand verbuddelt hätte. Es war laut, langsam und unpräzise. Ich denke, das war der Ausschlag, warum ich endlich was Besseres suchte. Fündig wurde ich dann bei der Canon EOS 7D. Eine tolle Kamera, die mich bis 2017 begleitet hat. Sie wurde im gleichen Jahr durch die Canon EOS 7D Mk II abgelöst. Was ich an der Kamera schätze: sie ist ungeheuer schnell und robust. Aber, so sehr ich die erste 7D geliebt habe – bei ISO-Werten über 1600 wurde es einfach nur gruselig. Die 400D hat schon bei ISO 800 den Löffel abgegeben.
Also was tun? Zu der Zeit war ich schon Mitglied einer Fotogruppe und irgendwann kam das Gespräch auf Vollformat. Zu der Zeit galt die Canon EOS 5D Mk II als Referenzkamera. Sie hatte nur einen entscheidenden Nachteil: den Preis. Canon schien das gespürt zu haben und brachte eine Einsteiger-Vollformat: die Canon EOS 6D. Die ging dann für vernünftiges Geld her und war bald auch meins. Endlich hohe ISO-Werte mit moderatem Rauschen. Mit der Zeit allerdings fand ich schnell raus woran dieses Modell krankte – schließlich war es ja auch ein vergleichsweise günstiges Modell. Während die ersten spiegellosen Sonys ihre Sensoren mit aberwitzig vielen Fokuspunkten zupflasterte, waren es bei der 6D nur mal gerade 12. Das ist aus der Hüfte geschossen noch verschmerzbar – schließlich kann ich die Kamera schwenken und den Fokus halten – auch wenn’s immer etwas seltsam aussieht, aber auf dem Stativ … ?! Und dann noch dieser etwas magere Dynamikumfang. So wurde jetzt 2018 die 6D wieder ausgemustert – das Nachfolgemodell kam für mich nicht in Frage. Seitdem bin ich Besitzer eine EOS 5D Mk IV. Damit habe ich zumindest für den Moment mein Wunsch-Setup erreicht: die 7D Mk II für schnelle Sachen und lange Brennweiten (ist ja APSC mit 1,6 Cropfaktor) und die 5D MK IV für Landschaft und Studio. Aber wer weiß, was die Zeit so mit sich bringt…
Ja ja ja, ich höre die Einwände, warum das eine oder andere Kamera-Modell viel besser sei. Das mag objektiv betrachtet auch stimmen. Eine Nikon D850 oder eine Sony Alpha 7 III R sind super Kameras. Der eigentliche Grund, warum man nicht mal eben schnell den Hersteller wechselt, liegt in den Tonnen von Glas, die sich mit der Zeit angesammelt haben. Alte Objektive verkaufen (mit deutlichem Verlust) und sich neue anschaffen (für sündhaft teures Geld) verbietet sich von alleine.
Inzwischen schreiben wir das Jahr 2024. Die Zeit der spiegellosen Kameras ist längst angebrochen und alle großen Hersteller haben mitgezogen. Dennoch widerstehe ich dem Reflex meine geliebte Canon 5D gegen eine neue Canon R5 umzutauschen, obwohl es durchaus Gründe gäbe, es zu tun – sei es zum Beispiel das ausklappbare Display, welches ich wirklich vermisse, oder aber die KI-gestützte Motiverkennung und -verfolgung. Alles wunderbare Dinge, nur die Preise bewegen sich langsam in Sphären, wo ich nicht mehr um jeden Preis mitgehe. Insbesondere bei Objektiven wie die RF-Reihe von Canon geht mir langsam die Luft aus. Statt also weiter zu technisch expandieren und auf neues Material umzusteigen, versuche ich mich gerade im Hinblick auf Städtereise zu verkleinern und habe mir nun eine Fuji X-S20 zugelegt. Zwar APSC, aber dafür klein und leicht. Und alle aktuellen Spielereien sind auch an Bord. Außerdem hat die Kamera etwas, was mir gefällt: ein Touch von Retro-Design. Sehr gelungen und zusammen mit einem 18-55 F2.8-4 ein wunderbares Set zum immer dabei haben.
Und seien wir ganz ehrlich – wir sollten auf dem Teppich bleiben: nicht die Kamera ist der limitierende Faktor für ein gutes Foto – sondern der Fotograf.
Zeit für’s Fotografieren
Ja, es ist ein Dilemma: ohne Fotografie fehlt mir etwas, fühle mich unausgeglichen und suche nach der kleinsten Möglichkeit mich damit zu beschäftigen. Dieser Effekt tritt umso heftiger auf, je weniger Zeit ich eigentlich dafür zur Verfügung habe. Der Alltag ist meist ziemlich streng durchgetaktet. Die Zeit für’s Fotografieren muss ich mir manchmal buchstäblich aus den Rippen schneiden. Und hier kommt das Dilemma: genau dann kommt nix dabei rum. Es fehlt die Entspanntheit, sich mal zurückzulehnen und etwas auf sich wirken zu lassen. Alles muss reingepresst werden in das Zeitfenster, das einem zur Verfügung steht – ohne Plan, ohne konkrete Vorstellung, was genau man eigentlich will. Befolgt man dazu noch die Grundregeln der Fotografie wonach der Fotograf tagsüber die meiste Zeit frei hat, schrumpft die verfügbare Zeit auf Null. Das ist der Augenblick, wo das Motiv zu mir kommen muss, obwohl es umgekehrt sein sollte. Und dann geht’s schief.
„Zum Fotografieren braucht man Zeit.
Wer keine Zeit hat, kann ja knipsen.“
Am besten klappt es, wenn das Bild in meinem Kopf schon fertig ist. man kann sich vorbereiten und sich auch mit äußeren Einflüssen wie Wetter oder Lichtstimmung intensiver auseinandersetzen. Klar, geht nicht immer gut, aber in aller Regel geht man nicht mit Nichts nach Hause – irgendetwas geht immer. Ich erinnere mich an eine Geschichte, bei der im Winter ich um vier Uhr morgens aufgestanden bin, um von Greifswald auf die Insel Rügen nach Sellin zu fahren. Dort wollte ich in Ruhe die Seebrücke mit ihrer Beleuchtung fotografieren, bevor die ersten Frühaufsteher am Strand unterwegs sind. Alleine, als ich ankam, lag die Seebrücke im Dunkeln – keine Beleuchtung. Ich schoss in meinen ganzen Frust dennoch ein paar Fotos und hatte meine Ausrüstung bereits wieder zusammengepackt, als offensichtlich jemand ein Einsehen mit mir hatte und die Beleuchtung eingeschaltet wurde.

Seebrücke Sellin (Insel Rügen)
Inspiration
Wer sich die Bilder auf meiner Website angesehen hat, wird feststellen, dass es sich um ein relativ weites Spektrum der Fotografie handelt. Warum habe ich mich nicht spezialisiert? Warum nicht nur Portraitfotografie oder warum nicht nur Bilder von der Ostsee? Der Grund ist für mich ganz einfach: wer sich spezialisiert ist in seinem Fach besonders gut, verliert aber darüberhinaus für alle anderen Themen die Perspektive. Die Fotografie ist ein endloses Experiment und ein ständiges Ausprobieren. Nicht alles gelingt, aber die Neugierde daran, Dinge auszuprobieren ist da. Inspiration hole ich mir viel über Fachzeitschriften, Communities, Workshops, über Fotogruppen, Ausstellungen oder einfach im Fachgespräch mit anderen. Dabei setze ich Inspiration nicht mit der eigenen Kreativität gleich. Ich ertappe mich häufig bei dem Gedanken wie: wieso bin ich nicht von selbst darauf gekommen? Berechtigte Frage. Bin ich unkreativ? Nein, höchstens in meiner Schaffenshöhe begrenzt. Aber über die Inspiration erweitere ich meinen eigenen kreativen Horizont. Und das ist gut.